Es gibt ja noch Bundesländer, die einigermaßen kontinuierlich über die länderspezifischen Erfahrungen mit Bildungsurlaub/Bildungsfreistellung berichten. So haben Niedersachen und Rheinland-Pfalz 2015 erneut Berichte vorgelegt, die durchaus von allgemeinem Interesse sind.
Der „Elfte Bericht“ aus Rheinland-Pfalz (über die Daten 2013/2014) zeigt (mit 845 Institutionen) eine stabile Anbieter-Landschaft. Veranstaltungen der gesellschaftspolitischen Bildung machen 16 % der Anerkennungen aus, 84 % dienen der beruflichen Weiterbildung, 2% der Verbindung beider Bereiche. Die Quote der Inanspruchnahme beträgt (wie im Berichtszeitraum davor) 2 %, bei den Auszubildenden, deren Recht 2013 eingeführt wurde, 1,2 %. In der beruflichen Bildung gibt es einen Trend zu längeren Veranstaltungen, 42 % aller Veranstaltungen dauern länger als fünf Tage. Und bemerkenswerterweise haben Intervallveranstaltungen mit 30 % einen immer größeren Stellenwert erlangt. Arbeitnehmer unter 40 Jahren werden überdurchschnittlich gut erreicht, Frauen eher unterdurchschnittlich. Top-Themenbereiche der beruflichen Bildung sind Fremdsprachen und Kaufmännisches, in der politischen Bildung „Gesellschaft“ und „Deutschland“.
Aus Niedersachsen wird über die vier Jahre 2009-2013 berichtet: Der Anteil beruflicher Weiterbildung – lange Jahre bei ca. 50% – lag 2013 bei 58 %, die politische Bildung zeigte sich mit Anteilen zwischen 17 und 20 % stabil. 52 % der Teilnehmenden haben an Angeboten der anerkannten niedersächsischen Weiterbildungseinrichtungen teilgenommen. Die Inanspruchnahme des Rechts auf Freistellung konnte leicht gesteigert werden – von 1,25 auf 1,48 %; andere Berechnungsweisen, unter Berücksichtigung der betrieblichen Grenzen und der real beanspruchten Tage, kommen auf eine Quote um 3 %. Teilnehmende aus dem Öffentlichen Dienst sind deutlich rarer geworden, Kleinbetriebe konnte besser erreicht werden.
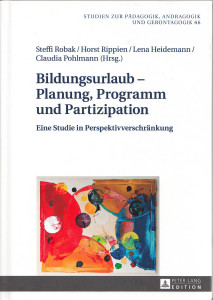 Auf die verdienstvolle Bremer Studie zu den Entwicklungschancen des Bildungsurlaubs und die daraus folgenden bildungspolitischen Empfehlungen wurde hier schon einmal hingewiesen (im Juni 2014). Inzwischen ist für die, die es genauer wissen wollen, auch die Gesamtstudie greifbar:
Auf die verdienstvolle Bremer Studie zu den Entwicklungschancen des Bildungsurlaubs und die daraus folgenden bildungspolitischen Empfehlungen wurde hier schon einmal hingewiesen (im Juni 2014). Inzwischen ist für die, die es genauer wissen wollen, auch die Gesamtstudie greifbar: